Ackerbohne, Vicia faba
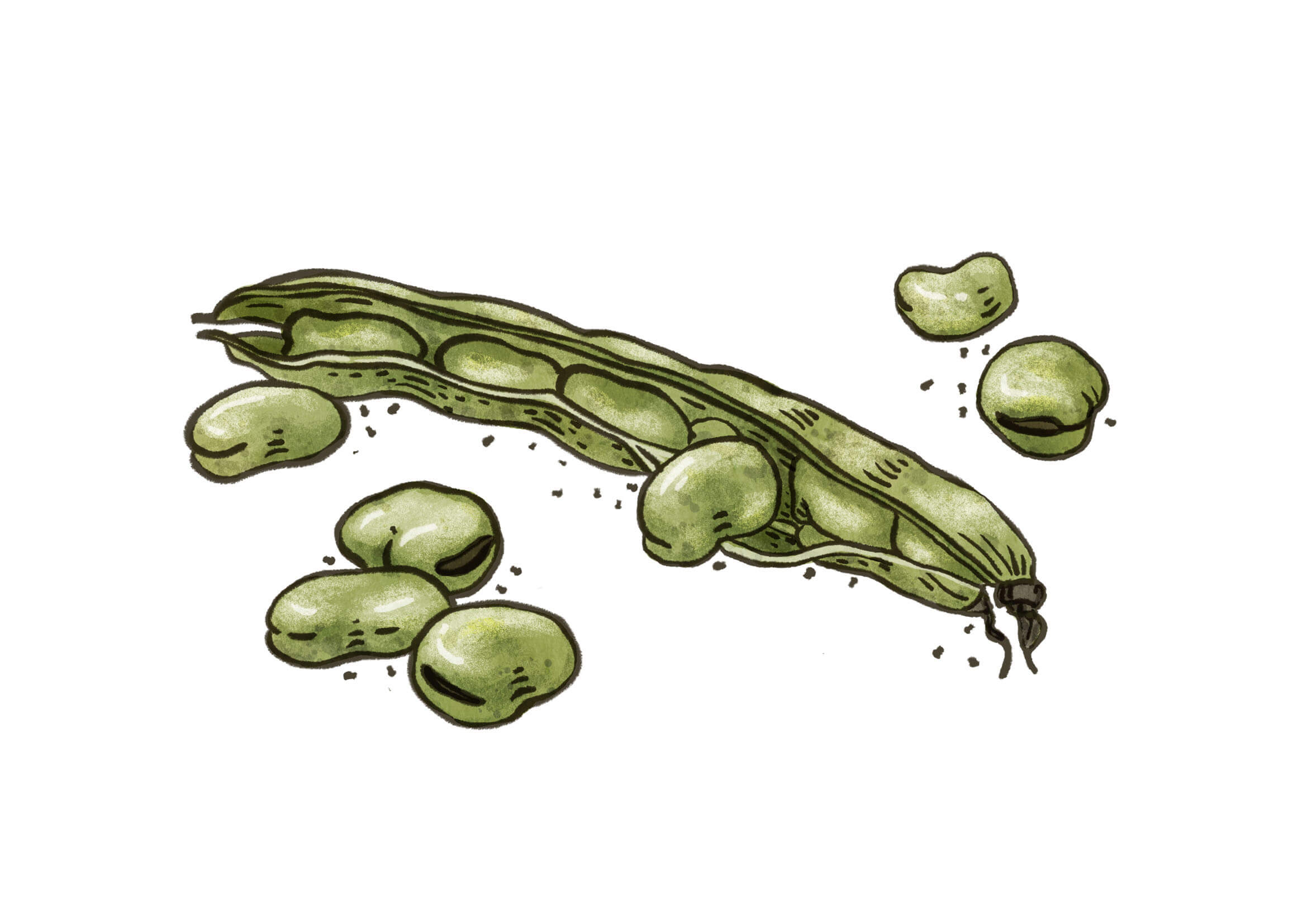
Fläche global: 3,1 Millionen Hektar
Fläche auf dem Weltacker: 4 m² (0,2%)
Herkunftsregion: südliches Mittelasien / Mittelmeerraum
Hauptanbaugebiete: Indien, Pakistan, China
Verwendung / Hauptnutzen: Lebensmittel, Viehfutter, Gründüngung
Ackerbohnen sind in Ägypten und im Sudan das Nationalgericht: Ful Medames oder Ful Mudammas ist ein Eintopf aus mit Gewürzen gekochten Ackerbohnen, der oft in einer flachen Schale mit Olivenöl und Petersilie serviert wird. «Mudammas» heißt «begraben» und tatsächlich wird das Gericht oft in mit heißer Asche bedeckten Tontöpfen über Nacht gekocht. Das Gericht ist im ganzen arabischen Raum verbreitet und wird oft mit Fladenbrot als Frühstück serviert. In Ägypten ist Ful Mudammas auch als Streetfood sehr beliebt.
Geliebt von Bienen und Hummeln
Die Ackerbohne wird also viel gegessen, doch von was für einer Pflanze können wir sie ernten? Die Ackerbohne gehört wie alle anderen Bohnen zur Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Doch im Gegensatz zur Gartenbohne ist sie nicht Teil der Gattung Phaseolus, sondern in der Gattung der Wicken (Vicia) eingeteilt. Genauso wie die meisten Wicken ist die Ackerbohne eine einjährige krautige Pflanze. Anders als die meisten Wicken ist sie jedoch keine rankende Pflanze, sondern hat einen kräftigen und stabilen aufrechten Stängel.
Bekommt die Pflanze genügend Niederschläge, kann sie über einen Meter hoch werden -die größten Exemplare erreichen sogar bis zu zwei Meter Höhe. Ihr Stängel ist viereckig und die Blätter sind gefiedert. Ihre Blüten sind aber nicht erst hoch am Stängel zu sehen, sondern als Frühblüher bildet die Ackerbohne schon sehr früh in ihrer Entwicklung relativ nah am Boden die ersten Blüten. Diese sind typische Schmetterlingsblüten. Oft sind sie weiß, manchmal mit dunklen Flecken an der Basis der Kronenblätter (das sind die «Flügel» der Schmetterlingsblüten). Seltener gibt es auch rötliche und lila Farbtöne bei den Blüten. Unabhängig von der Farbe sind die Blüten sehr attraktiv für Bienen und Hummeln. Diese müssen aber einige Kraft aufbringen, um durch die Blütenblätter zum Nektar zu kommen. Die Ackerbohne ist ein Fremdbefruchter, kann sich aber auch selbst befruchten. Wenn zwei verschiedene Sorten in unmittelbarer Nachbarschaft stehen, ist die Wahrscheinlich für eine Kreuzung sehr hoch.
Die Ackerbohne bildet aufrecht bis schräg gestellte Hülsen mit zwei bis sechs großen Samen. Die reifen Samen sind von beige über braun bis zu rot oder dunkel gefärbt. Weil die Samen bei vielen Sorten so dick sind, werden sie auf Deutsch auch «Dicke Bohnen» genannt. Die jungen Schoten und Samen können frisch geerntet oder später als ausgereifte Bohnen geerntet und getrocknet werden. Je nach klimatischen Bedingungen und Höhenlage werden die Ackerbohnen als Wintersaat oder als Frühlingssaat angebaut.
Wo wächst die Bohne?
Ackerbohnen haben einen hohen Wasserbedarf. Sie gedeihen gerne in Böden, die die Feuchtigkeit gut halten oder an Orten mit genügend Niederschlag. Auch in raueren Gegenden können Ackerbohnen wachsen. Wer Ackerbohnen anbaut, sollte dem Boden jedoch Zeit zur Erholung geben: Erst nach vier bis fünf Jahren sollte an derselben Stelle wieder gesät werden.
Wie alle Hülsenfrüchtler (Fabaceae) können Ackerbohnen mit Hilfe von stickstofffixierenden Bakterien Stickstoff im Boden anreichern. Die Rhizobien – so heißen diese Bakterien – befinden sich in stecknadelgroßen Knöllchen an den Wurzeln. Zuerst profitiert die Ackerbohne selber von dieser Symbiose, nach ihrem Absterben steht der übriggebliebene Stickstoff anderen Pflanzen als natürlicher Dünger zur Verfügung. Diese positive Wirkung der Hülsenfrüchte auf ihre Nachfrüchte muss schon den Bäuer:innen in den Anfangszeiten des Ackerbaus aufgefallen sein – das zeigen frühe Quellen.
Kulturgeschichte der Ackerbohne
Es wird vermutet, dass die Ackerbohne im südlichen Mittelasien und im Mittelmeerraum ihren Ursprung hat. Die erste Kultivierung fand wohl vor ca. 9000 Jahren in Vorderasien statt. In Europa nördlich der Alpen wird sie seit Ende der Bronzezeit vor 2000 Jahren als wichtiges Nahrungsmittel angebaut. Damals wanderte sie auch bis an die Nordseeküste und wurde dort gerne angebaut, weil sie als einzige Hülsenfrucht auch auf salzigen Böden in Küstennähe gedeiht. Bei Ausgrabungen hat sich aber gezeigt, dass diese frühen Formen der «Dicken Bohne» noch gar nicht sehr dick waren.
Im Mittelalter war die Ackerbohne in ganz Europa eines der wichtigen Nahrungsmittel und wertvolle Proteinquelle. In dieser Zeit entwickelten sich auch die ersten Sorten mit großen Samen. Damals wurde die Ackerbohne auf Deutsch nur «Bone» genannt. Konkurrenz bekam sie erst im 17. Jahrhundert: Die Gartenbohne und die Feuerbohne wurden aus Amerika eingeführt, die bei der Bevölkerung bald viel beliebter waren. So ging der menschliche Konsum von Ackerbohnen stark zurück und sie wurde hauptsächlich noch als Viehfutter angebaut.
Heute ist China der größte Ackerbohnenproduzent der Welt und produziert hauptsächlich für den inländischen Konsum – Export spielt kaum eine Rolle. In Ostchina werden vor allem Ackerbohnen mit großen Schoten als Frischgemüse und für die Weiterverarbeitung in der Lebensmittelindustrie (z.B. für fermentierte Pasten) angebaut, während im nordwestlichen und südwestlichen China traditionell eher Sorten angebaut werden, die sich für die Ernte von getrockneten Bohnen gut eignen. Anders als z.B. in Australien, wo Ackerbohnen hauptsächlich für den Export produziert werden, ist die chinesische Ackerbohnenernte starken Schwankungen bezüglich Qualität unterworfen. Auch die Pilzkrankheit Fusarium und die Wurzelfäule verursachen immer wieder Ernteausfälle. Es gibt eine breite Sortenvielfalt und viele alte chinesische Landsorten. Ackerbohnen werden in China oft in Fruchtfolge mit Reis angebaut, daneben gibt es auch Mischkulturanbau mit Kiwi, Grapefruit, Datteln oder Beeren.
Ein Samen – viele Nutzungen
Ackerbohnen bestehen knapp zur Hälfte aus Kohlenhydraten. Dank der weiter oben erwähnten Symbiose mit den Rhizobien enthalten sie zwischen 20 und 30 Prozent pflanzliche Eiweiße. Daneben enthalten Ackerbohnen auch viele Ballaststoffe und Wasser. Allerdings sind Ackerbohnen roh giftig und müssen vor dem Verzehr gekocht, geröstet oder sonst verarbeitet werden. Neben ihrer Verwendung als Frischgemüse oder getrocknete Bohnen werden Ackerbohnen vielerorts auch als bodenverbessernde Gründüngung sowie als proteinreiches Futtermittel angebaut. Die deutschen Synonyme Saubohne, Schweinsbohne, Pferdebohne und Viehbohne zeigen diese Verwendung eindrücklich. Allerdings darf der Ackerbohnengehalt nur 5-10 Prozent des Gesamtfutters ausmachen. Zu viel Ackerbohnen wären giftig für das Vieh und würden zu Leberschäden und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
Auch für manche Menschen, denen das Enzym «G6PD» fehlt, können Ackerbohnen gefährlich sein. Sie reagieren auf zwei Inhaltsstoffe der Ackerbohne (Vicin und Convicin) mit Kopfschmerzen, Übelkeit und in seltenen Fällen mit einer lebensbedrohlichen, gelbsuchtähnlichen Blutarmut. Dieser sogenannte Favismus kommt überproportional häufig bei der schwarzen Bevölkerung des östlichen Mittelmeerraumes und bei Afroamerikaner:innen vor. Durch Rösten, Einweichen und Kochen kann der Gehalt von Vicin und Convicin deutlich reduziert werden. Lebensmitteltechniker:innen arbeiten daran, diese kritischen Stoffe im Verarbeitungsprozess zu entfernen und auch die Pflanzenzüchtung hat Ackerbohnensorten mit geringen Gehalten dieser beider Stoffe hervorgebracht.
Das in der Ackerbohne enthaltene Lectin L-Dopa ist Ausgangsmaterial für Präparate zu Behandlung von Morbus Parkinson und es gibt ein Pflanzenpharmakon zur Vorbeugung und Behandlung von Parkinson, für welches die ganze Ackerbohnenhülse verwendet wird. Auch in anderen Naturprodukten aus der Ackerbohne ist der Wirkstoff L-Dopa drin. Allerdings ist hier der Gehalt nicht immer gleich hoch und daher die für Parkinson-Patienten erforderliche genau Dosierung nicht möglich.
Großes Potenzial für die Zukunft
In den letzten Jahren kam die Ackerbohne vielerorts wieder ins Gespräch als Alternative zu klimaschädlichen Sojaimporten aus den Tropen. Tatsächlich könnte die Ackerbohne gerade an Orten mit rauem Klima eine gute Möglichkeit zum inländischen Anbau von pflanzlichen Proteinen darstellen. Auch verarbeitete Formen der Ackerbohne wie Mehl, Schrot, Proteinisolat oder -konzentrat fanden in den letzten Jahren vermehrt Eingang in die Lebensmittelindustrie und werden zum Beispiel in Fleischersatzprodukten, aber auch in Brot und Backwaren oder Desserts eingesetzt. Allerdings steckt hier die Forschung vielfach noch in den Kinderschuhen und wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft bringt.
Quellen
Peter Schilperoord: Kulturpflanzen in der Schweiz – Ackerbohne. Link.
Yu et al. (2023): Production status and research advancement on root rot disease of faba bean (Vicia faba L.) in China. Link.
Botanikus: Ackerbohne, Dicke Bohne. Link.
Süddeutsche Zeitung: Die Wunderbohnen. Link.
UFOP: Die Ackerbohne. Link.
Biologieseite: Ackerbohne. Link.






