Banane, Musa spp.
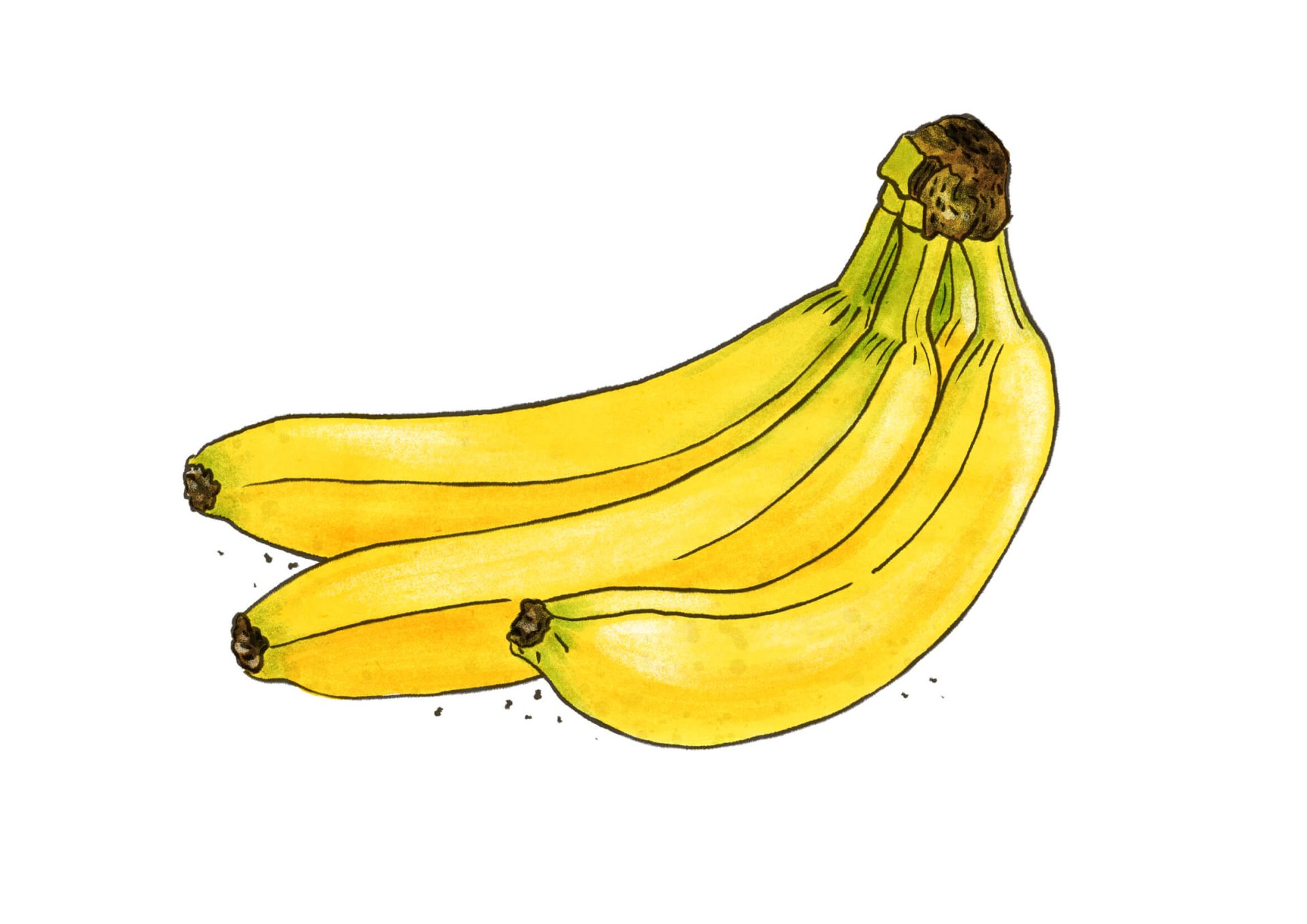
Fläche global: 12,8 Millionen Hektar, davon 54% Kochbananen
Fläche auf dem Weltacker: 16,2 m² (0,8%)
Herkunftsregion: Südostasien
Hauptanbaugebiete: Uganda, Kongo, Indien
Verwendung / Hauptnutzen: Zum Kochen, Obst
Bananen sind die Fürchte, die frisch weltweit am meisten exportiert werden – etwa in einem Handelsvolumen von 10 Milliarden US-Dollar jährlich. Sie sind eine wichtige Einnahmequelle für Tausende von ländlichen Haushalten im Globalen Süden. Die starke Abhängigkeit von Agrochemikalien in der Produktion und die sinkenden Preise für die Erzeuger:innen haben jedoch zu erheblichen ökologischen und sozialen Herausforderungen geführt.
Eine Beere aus den Tropen
Die Banane ist eine mehrjährige, krautige Pflanze, die bis zu sechs Meter hoch wird. Sie bildet keinen Holzstamm, sondern einen Pseudostamm aus eng zusammengerollten Blattscheiden. Ihre großen, ledrigen Blätter wachsen in Spiralen, während die Früchte in großen Stauden an der Pflanze hängen. Botanisch betrachtet, handelt es sich bei der Banane um eine Beere. Die Pflanze benötigt tropisches Klima mit regelmäßigen Niederschlägen und ist äußerst produktiv. Sie vermehrt sich sowohl durch Samen als auch vegetativ über Schösslinge, die direkt aus dem Wurzelsystem der Mutterpflanze sprießen.
Obwohl es weltweit über 1.000 bunte Bananensorten gibt, hat sich insbesondere die Cavendish-Banane auf den Märkten durchgesetzt und ist in vielen Supermärkten als Obst zu finden. Dabei gibt es eine beeindruckende Vielfalt an Farben, Formen und Geschmacksrichtungen, die von roten und blauen bis hin zu kleinen, süßen Bananen reicht. Diese Vielfalt wird oft übersehen, da der internationale Handel hauptsächlich auf diese eine Sorte fokussiert ist.
Nahrungsgrundlage und Exportschlager
Die Banane stammt ursprünglich aus Südostasien und wurde vor über 7.000 Jahren kultiviert. Händler brachten sie nach Afrika und in die tropischen Gebiete Amerikas. Indien ist heute der größte Produzent von Obst-Bananen, in Uganda und im Kongo werden die meisten Kochbananen angebaut. Kochbananen sind in vielen Ländern Subsahara-Afrikas ein wichtiges Grundnahrungsmittel.Allerdings dominieren Lateinamerikas Länder wie Ecuador und Brasilien den Exportmarkt. Der Anbau erfolgt häufig in Monokulturen, insbesondere in großen Plantagen, die auf den internationalen Export ausgerichtet sind. Daneben spielt die Banane in vielen tropischen Ländern auch als Nahrungsgrundlage für den lokalen Verzehr eine wichtige Rolle und wächst in zahlreichen Gärten.
Der bekömmliche Allrounder
Bananen sind reich an Nährstoffen wie Kalium, Vitamin C und Ballaststoffen. Sie unterstützen die Herzgesundheit, tragen zur Regulierung des Blutdrucks bei und sind eine leicht verdauliche Energiequelle. Darüber hinaus sind Bananen aufgrund ihres geringen Fettgehalts und der hohen Nährstoffdichte bei Sportler:innen und Menschen mit Verdauungsproblemen sehr beliebt. Kulinarisch bieten sie eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten: von frischem Verzehr bis hin zur Zubereitung von Smoothies, Desserts und Backwaren. Kochbananen werden in vielen tropischen Ländern als stärkehaltiges Grundnahrungsmittel gekocht, gebraten oder gebacken. Die Kochbananen können als Brei genossen werden, wie beispielsweise das Frühstücksgericht Mangú aus der Dominikanischen Republik. In Asien und Lateinamerika werden Kochbananen auch als Teil von Currys verspeist, in Afrika werden sie gebraten, in Suppen und Eintöpfen oder als Fufu verspeist. Die kulinarischen Optionen sind zahlreich und abwechslungsreich – eine Entdeckungsreise durch die Kochbananen-Gerichte lohnt sich definitiv.
Übrigens: Die Blätter der Bananenstauden werden als Verpackung und Teller genutzt.
Wie die Panama-Krankheit den weltweiten Bananenkonsum veränderte
Bis in die 1950er Jahre war die Gros Michel die dominierende Bananensorte, bevor sie fast vollständig durch die Panama-Krankheit (Tropischer Rasse 1) ausgelöscht wurde. Um die Versorgung zu sichern, wurde die resistentere Cavendish-Banane weltweit eingeführt. Sie ist auch heute noch die gängige Bananensorte auf dem Weltmarkt. Das bekannte künstliche Bananenaroma stammt aber nach wie vor von der früheren Gros Michel und unterscheidet sich daher vom Geschmack der heutigen Cavendish-Banane. Ironischerweise steht die Cavendish heute vor einer ähnlichen Bedrohung: Die Tropische Rasse 4 (TR4), eine aggressivere Variante desselben Pilzes, breitet sich aus und gefährdet die weltweiten Bananenbestände. Da viele Plantagen in Monokulturen betrieben werden, verbreiten sich solche Krankheiten schnell und können Ernteausfälle verursachen. Anbaupausen, Mischkulturen und Fruchtwechsel können der Verbreitung des Pilzes entgegenwirken.
Die Bananenplantagen: Orte der Ausbeutung
Auf vielen Bananenplantagen in zahlreichen Ländern gibt es gravierende Verletzungen der Rechte der Plantagen-Arbeitenden: Viele Landarbeitende sind schlecht entlohnt und gesundheitlichen Risiken durch den Einsatz von Pestiziden ausgesetzt. Die UN-Sonderberichterstatterin für moderne Formen der Sklaverei bezeichnete die Bedingungen in Ecuadors Bananenplantagen 2010 als „mit der Sklaverei vergleichbar”.
Ecuador ist seit den 1950er Jahren der größte Bananenexporteur der Welt. Knapp ein Drittel der auf dem Weltmarkt gehandelten Bananen stammen von hier. Das Land hat rund 5000 Bananenproduzent:innen, von kleinsten Familienbetrieben bis zu Großproduzenten. Die Bananen werden von ihnen meistens an Zwischenhändler verkauft, die sie dann internationalen Unternehmen wie Chiquita oder Dole weiterverkaufen. Diese großen Player besitzen selbst kaum eigene Plantagen und diktieren den Zwischenhändlern die Marktbedingungen, welche sie dann wiederum bei den Bananenproduzenten durchsetzen. Leidtragende sind die Kleinproduzent:innen und Landarbeiter:innen, die ausgebeutet werden und sich kaum gegen Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit und Löhne unter dem Mindestlohn wehren können. Auch das Versprühen von hochgiftigen Pestiziden ist ein schwerwiegendes Problem: Gemäß Oxfam setzen die großen Bananenproduzenten im Schnitt 40 Sprühzyklen pro Jahr ein. Aus der Luft werden großflächig hochgiftige Substanzen versprüht, die in der EU längst verboten sind. Ein Gesundheitsrisiko für Landarbeiter:innen, die oftmals schon nach wenigen Stunden wieder auf die Plantagen zurückkehren müssen und auch für Anwohner:innen, da die Mindestabstände zu bewohnten Gebieten oftmals nicht eingehalten werden.
Der lange Weg der Banane
Damit Konsument:innen auf der ganzen Welt jederzeit reife Bananen kaufen können, werden Bananen vollständig grün geerntet. Die Bananen kommen in Kühlcontainern, wo der Reifeprozess gestoppt wird. Auf Kühlschiffen werden sie bis ins Zielland transportiert und dort in sogenannten Reifekammern durch gezielte Begasung und Temperaturanstieg zur Reifung gebracht, was vier bis acht Tage dauert. Danach werden die Bananen in LKWs zu den Supermärkten gebracht, wo sie dann in der gewünschten gelben oder noch leicht grünen Farbe zum Verkauf angeboten werden. Hinter unserer “alltäglichen” Banane im Supermarkt steckt also ein hochkomplexer Prozess, der einen hohen Energie- und Ressourceneinsatz benötigt. Wenn sie also nicht regional angebaut wird, sollte die Banane mit Bedacht verspeist und die Herkunft und Sorte bewusst gewählt werden.
Gegen den Biodiversitätsverlust
Der großflächige Anbau von Bananen in Monokulturen trägt erheblich zum Verlust der biologischen Vielfalt bei. Laut der FAO ist die Landwirtschaft für 70 % des globalen Biodiversitätsverlusts verantwortlich, besonders in Ländern des Globalen Südens. Monokulturen, wie z. B. der Bananenanbau in Costa Rica und der Dominikanischen Republik, führen zu Bodenerosion, Wasserknappheit und Umweltverschmutzung. Die intensive Nutzung von Land zerstört Lebensräume und gefährdet zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Das Projekt „Del Campo ogl Plato“ förderte biodiversitätsfreundliche Initiativen in Costa Rica und der Dominikanischen Republik, die Bananenplantagen ökologisch gestalten. Dazu gehören die Schaffung von Biotop-Korridoren, die Nutzung von Naturfasern aus Ananasstoppeln sowie der Einsatz von Mikroorganismen zur Verbesserung der Bodenqualität. Besonders beeindruckend ist der innovative Einsatz von Regenwurmhumus und Drohnentechnologie, um den Wasserverbrauch zu senken und langfristig Erträge zu sichern. Diese Maßnahmen zeigen, wie Biodiversität und Landwirtschaft vereint werden können.
Quellen
Klett. TERRA Geschichte Erdkunde Politik-Online: Infoblatt Banane. Link.
Spektrum.de. Lexikon der Biologie: Bananengewächse. Link.
Oxfam Deutschland: Edeka-Bananen aus dem Giftnebel. Link.
Public Eye: Solange der Preis stimmt. Chiquitas Geschäfte in Ecuador und die Arbeitsbedingungen in den Plantagen. Link.
Südwind. Institut für Ökonomie und Ökumene: Logistik und Menschenrechte: Ungleichheit im Bananen-Business. Link.
Del Campo al Plato: Biotop-Korridore. Link.
