Zuckerrohr, Saccharum officinarum
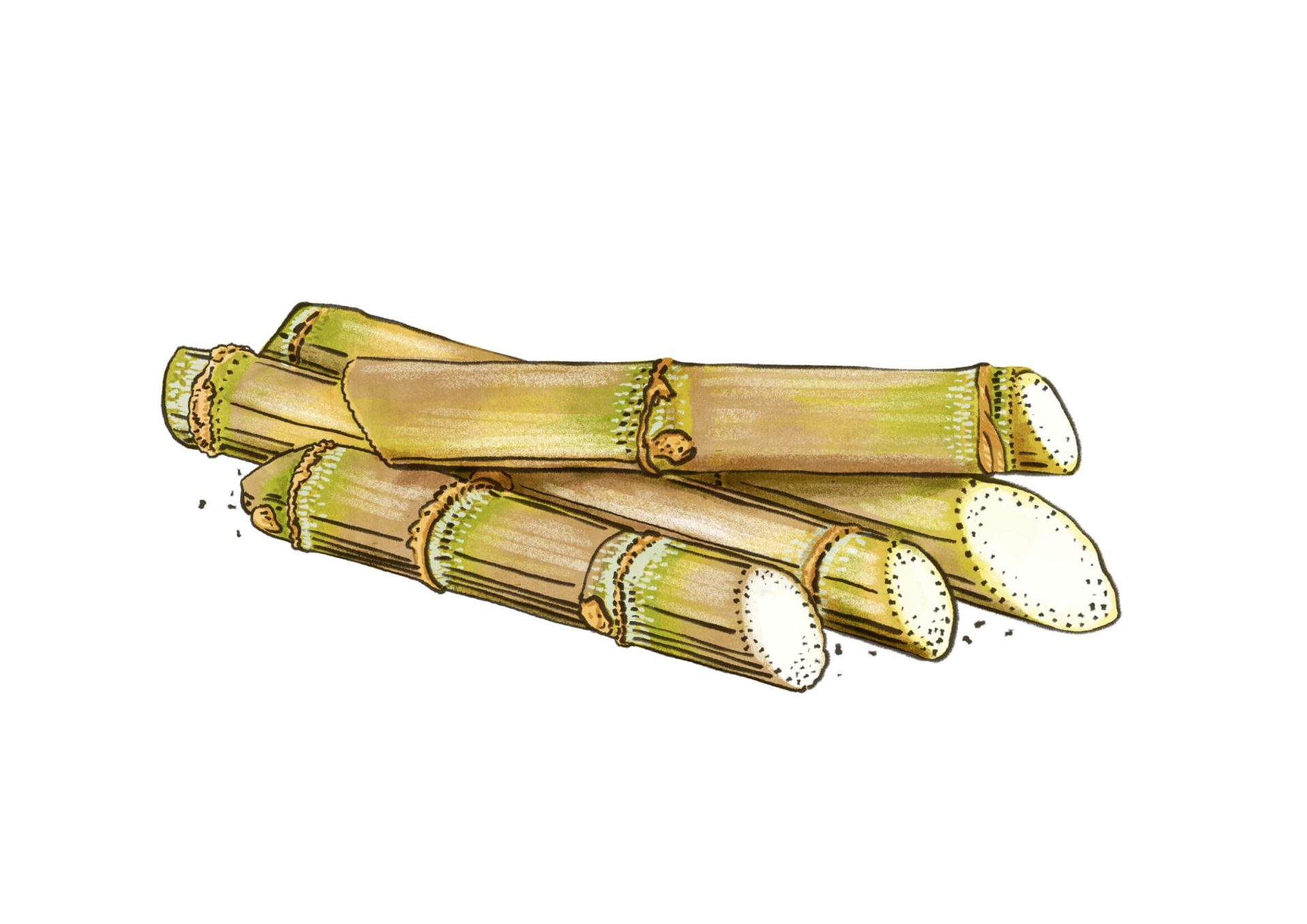
Fläche global: 26,3 Millionen Hektar
Fläche auf dem Weltacker: 33 m² (1,7%)
Herkunftsregion: Melanesien, Inselgruppe nordöstlich Australiens
Hauptanbaugebiete: Brasilien, Indien, Thailand
Verwendung / Hauptnutzen: Saccharose (Zucker), Treibstoff, Papier, Tierfutter
Zuckerrohr war für viele Jahrtausende die Basis für die Zuckerproduktion, bis vor etwa 200 Jahren die Zuckerrübe als Konkurrentin antrat. War Zucker zuerst selten und teuer, so wurde er später zu einem der ersten industriell hergestellten Welthandelsgüter – und damit durch die Jahrhunderte ein Treiber für Kriege, koloniale Sklaverei und Spekulation.
Pflanze mit Ansprüchen
Zuckerrohr gehört zur Familie der Süßgräser, ist mehrjährig und kann bis zu sieben Meter hoch werden. Die krautige Pflanze kann aufgrund der Größe ihrer Blätter und den ausgebildeten büscheligen Blütenständen mit blühenden Maispflanzen verwechselt werden. Das Innere der langen, bis zu 5 cm dicken Halme besteht zu 9-16 Prozent aus kristallisationsfähigem Zucker.
Die Pflanze gilt als sehr empfindlich, da für ihr Wachstum eine konstante Wärme von 25 bis 28 Grad Celsius und stickstoffhaltige und tiefgründige Böden optimal sind. Bei Temperaturen unter 15 Grad Celsius wächst sie nicht weiter. Der Boden muss während des Wachstums sehr gezielt bewässert und vor der Ernte trocken gehalten werden. Zuckerrohr wird daher nur in tropischen und subtropischen Regionen angebaut.
Der Erntezeitpunkt richtet sich nach einer pflegeintensiven Wachstumszeit von 10 bis 24 Monaten nach dem Zuckergehalt der Pflanze. Für die Ernte werden die zuckerhaltigen Halme nah am Boden abgeschnitten und alle Blätter entfernt, denn diese enthalten keinen Zucker. In den Ländern des Globalen Südens erfolgt dieser Arbeitsschritt zumeist in mühevoller, unterbezahlter Handarbeit. Im Anschluss folgen verschiedene Mahl-, Koch und Reinigungsprozesse. Die im Boden zurückgebliebenen Stängelabschnitte treiben ohne großen Aufwand erneut aus und erlauben nach 10 bis 12 Monaten die nächste Ernte. Die Lebensdauer einer Zuckerrohrpflanze ist regional unterschiedlich. So wird in Indien oft zweijährig und in Brasilien teilweise fünfjährig angebaut. Eine Zuckerrohrpflanze kann bis zu zwanzig Jahre alt werden.
Grausame Süße – die Geschichte des Zuckerrohrs
Als Ursprung der Pflanze und ihrer Nutzung zur Zuckergewinnung gilt der ostasiatische Raum. Vermutet wird, dass es auf den melanesischen Inseln schon vor 10.000 Jahren roh verspeist wurde. Von dort verbreitete sich Zuckerrohr in Asien – von den Philippinen bis Indien. Durch den Handel gelangte es dann viele tausend Jahre später, ab dem sechsten Jahrhundert n. u. Z. in den persischen und arabischen Raum und bis nach Spanien, Ägypten und Sizilien.
Nach Mitteleuropa gelangte die Pflanze durch die europäischen Kreuzzüge der Christen erst über tausend Jahre später. In Mitteleuropa war Zuckerrohr aber klimabedingt nicht kultivierbar. Allerdings wurden während der Kreuzzüge die arabischen Zuckerrohranbaugebiete im Mittelmeerraum von Christen übernommen. Der gewonnene Zucker wurde so langsam eine Alternative zum Honig, blieb aber zunächst sehr teuer und somit den Oberschichten vorbehalten. Bis zur Entdeckung des Rübenzuckers1796 war Zuckerrohr die einzige bekannte Quelle zur Gewinnung von Zucker.
Christoph Kolumbus brachte Zuckerrohrpflanzen in die Karibik, die im 16. Jahrhundert zur Zuckerrohr-Hochburg wurde. Etwa zeitgleich gelangte sie durch portugiesische Kolonialisten in den westafrikanischen Raum. Schnell wurde klar, dass die feuchtwarmen, tropischen Klimabedingungen für Anbau und Ertrag ideal waren. In kurzer Zeit entstanden so in den kolonisierten Gebieten große Plantagen für die zahlreiche Indigene gewaltsam von ihrem Land vertrieben wurden. Auf diesen Plantagen arbeiteten meistens westafrikanische Sklav:innen. Neben dem Anbau von Baumwolle und Tabak spielte auch der Anbau von Zuckerrohr eine bedeutende Rolle im grausamen, transatlantischen Sklavenhandel. Denn auch die Zuckergewinnung war Schwerstarbeit und der „Arbeitskräfteverschleiß“ forderte ständig Nachschub an vornehmlich jungen, männlichen Sklaven.
Französische Kolonialisten brachten zu Beginn des 18. Jahrhunderts den Zuckerrohranbau in den Süden der heutigen USA, der auch hier durch Ausbeutung von Sklav:innen schnell zum wichtigen Wirtschaftsfaktor wurde. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Teile der Zuckergewinnung mechanisiert, was den Arbeitskräftebedarf verringerte, die Erschließung größerer Anbauflächen ermöglichte und den Ertrag steigerte. Zucker blieb aber lange Zeit ein absolutes Luxusgut. Heute ist Zuckerrohr die weltweit wichtigste Pflanze zur Herstellung von Zucker und wird in fast allen feuchtwarmen Gebieten der Welt großflächig angebaut. Die Arbeit auf den Plantagen ist nach wie vor sehr hart und vor allem durch den Einsatz von Pestiziden gefährlich für Menschen und Natur. In Brasilien verlieren Kleinbäuer:innen ihr Land an Plantagenbesitzer und es werden weiter Regenwaldflächen gerodet und Gewässer verschmutzt.
Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden laut FAO weltweit fast 2 Milliarden Tonnen Rohrzucker und mehr als 260 Millionen Tonnen Zuckerrüben produziert. Damit basieren ca. 80% der globalen Zuckerproduktion auf Zuckerrohr. Die Produktion wird von Brasilien, Indien und China angeführt, bei einem Ertrag von etwas über 70 Tonnen pro Jahr und Hektar. Rohr- und Rübenzucker haben heute bei der Zuckergewinnung anstelle von sklavengetriebener Muskelkraft einen sehr hohen maschinengebundenen Energieeinsatz.
Schon gewusst?
Das Wort für „Zucker“ geht auf das altindische sárkara für Zerriebenes, Körniges, Kies zurück. Mit dem Indienfeldzug Alexanders des Großen (326 v. u. Z.) gelangte das altindische Wort ins Griechische (sakcharon), wovon sich der lateinische Begriff saccharum ableitete. Ebenfalls aus dem Altindischen entlehnt ist das arabische sukkar, das mit das mit der arabischen Herrschaft im Mittelalter nach Spanien und Sizilien kam und so Eingang in die romanischen Sprachen, wie Spanisch (azúcar), Französisch (sucre und davon abgeleitet das englische sugar) und Italienisch (zucchero) fand. Über das Italienische gelangte es ab 13. Jahrhundert in den deutschen Sprachraum.
Nicht gesund doch oft genutzt – Verwendung von Zuckerrohr
Zuckerrohr hat einen hohen Anteil an Saccharose und einen geringen an Traubenzucker (Glucose) und Fruchtzucker (Fructose) und wird deshalb als Zweifachzucker (Disaccharid) bezeichnet. Durch Pressen wird der Saft des Zuckerrohrs gewonnen und danach gereinigt, erhitzt und verdickt. Der gewonnene gelbbraune Rohrzucker wird mittels Raffination zu weißem Zucker verarbeitet. Aus etwa 1000 Kilogramm Zuckerrohr lassen sich etwa 100 Kilogramm Zucker herstellen.
100 Gramm Zucker enthalten 388 Kilokalorien und bestehen zu 94,5 Prozent aus Kohlehydraten, wobei Vollrohrzucker, der nicht raffiniert ist, noch mit unter 1 Prozent Mineralelementen aufwarten kann. Der Verzehr von zu viel raffiniertem Zucker ist entgegen allen Beteuerungen der Zuckerindustrie gesundheitsschädlich, während natürlicher Zucker, wie er in Früchten, Gemüse oder vollwertigen Lebensmitteln vorkommt, wichtig und gesund ist. Neben der Verwendung in Süßigkeiten steckt auch viel zugesetzter Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln wie Ketchup, Fertigsoßen, Tiefkühlpizzen, Fruchtjoghurts etc. Damit wird das Zuckerlimit oft unbemerkt überschritten – ganz ohne Softdrinks, Eis oder Schokolade. In der Folge steigt das Risiko für die Entstehung von Übergewicht, Fettleber, Diabetes und damit indirekt auch verschiedener Krebsarten. Auch Zahnkaries wird durch Zuckerkonsum gefördert.
Zuckerrohr im Tank und in Industrie
Zuckerrohr versüßt nicht nur unsere Speisen, sondern wird insbesondere zu Bioethanol verarbeitet. Bei der globalen Bioethanol-Produktion sind zwei Kulturen zentral: Mais und Zuckerrohr. Seit den 1980er Jahren ist die weltweite Ethanolproduktion enorm und unaufhaltsam gestiegen. Brasilien und die USA sind die zwei größten Produzenten – in den USA hauptsächlich auf Basis von Mais, in Brasilien dominiert das Zuckerrohr.
Für die Herstellung von Ethanol wird das zuckerhaltige Mark im Stängel der Pflanze benötigt. Das Zuckerrohr wird aufgebrochen und der Saft extrahiert. Dann kommt dieser Saft in einen Fermenter, wo der enthaltene Zucker mithilfe von Hefepilzen zu Ethanol verarbeitet wird. Nach Destillation und Entwässerung bleibt dann das Endprodukt: Bioethanol. Ein Nebenprodukt ist die Bagasse, die faserigen Reste des Zuckerrohrs. Diese können als Brennstoff genutzt werden. In Brasilien machen sie mittlerweile sogar 8 Prozent der Stromerzeugung aus.
Bagasse wird zunehmend aber auch als nachwachsender Rohstoff für die Produktion abbaubarer Kunststoffe (Bio-Plastik), für die Papier- und Kartonherstellung, für kompostierbares Einweg-Geschirr, als Werkstoff für Möbel, Türen und in der Automobilherstellung verwendet.
Die steigende Ethanolproduktion hat in Brasilien zu einer Ausweitung der Anbauflächen von Zuckerrohr geführt. Oftmals werden Weideflächen in Anbauflächen umgewandelt. Neben den riesigen Sojaflächen entstehen also auch immer größere Zuckerrohrplantagen. Doch während raffinierter Zucker global gehandelt wird, hat sich für Ethanol noch kein internationaler Markt gebildet. Das EU-Mercusor- Handelsabkommen könnte jedoch einen weiteren Schub in der Bioethanol-Produktion und im Export Brasiliens bringen: Die EU soll 450.000 Tonnen Ethanol zollfrei, für chemische Zwecke, sowie 200.000 Tonnen mit einem sehr geringen Zoll aus den Mercosur-Staaten importieren können, was etwa 50 Prozent der aktuellen Gesamtexporte entspricht.
Quellen
Sodi e.V.: history of Food – Recherchebericht Zuckerrohr. Link.
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e. V.: Zuckerträume. Ethanol aus Brasilien in der globalen Klimapolitik. Link.
Grafs Bio Seiten: Bioethanol aus Zuckerrohr. Link.
